TO EXPECT
THE UNEXPECTED
SHOWS A THOROUGHLY
MODERN INTELLECT
Oscar Wilde

TO EXPECT
THE UNEXPECTED
SHOWS A THOROUGHLY
MODERN INTELLECT
Oscar Wilde

TO EXPECT
THE UNEXPECTED
SHOWS A THOROUGHLY
MODERN INTELLECT
Oscar Wilde
WEISENHEIMER LEGAL
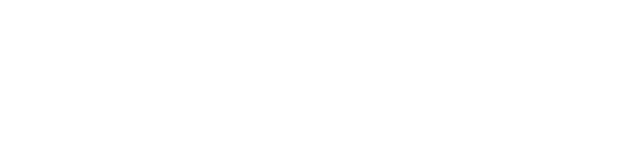
Substantiv – US Amerikanische Umgangssprache: Jemand, der alles (besser) weiß (Collins English Dictionary)
Also ein Besserwisser und Schlauberger.
Wir bei Weisenheimer Legal sind gerne Schlauberger. Wir finden, dass Sie die beste Beratung verdienen.
Jemand, der sich mit seinem gesamten Know-how in Ihr Unternehmen einbringt und die für Ihre Situation schlaueste und beste Lösung findet.
Jemand, der unternehmerisch denkt und die juristische Lösung stets an der wirtschaftlichen Zielsetzung orientiert.
Jemand, der Sie und Ihr Unternehmen kennt und versteht. Ihr persönlicher Weisenheimer.
UNSERE SCHWERPUNKTE
Weisenheimer Legal ist auf die Beratung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen sowie international tätigen Klienten spezialisiert und begleitet und berät diese in allen juristischen Belangen. Diese Klienten sind sowohl im nationalen als auch sehr stark im internationalen Bereich zu finden. Weisenheimer Legal kann auf umfangreiche Erfahrung mit erfolgreichen Unternehmen in den verschiedensten Segmenten verweisen, insbesondere ist unsere branchenspezifische Erfahrung im Bereich der IT und Life Science Industrie sowie der Luftfahrt gefragt. Auf Anfrage können wir gerne einige unserer Erfolgsgeschichten mit Ihnen teilen.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und der tiefen Kenntnis der Unternehmenslandschaft der Klein- und Mittelbetriebe sowie der international tätigen Klienten, wissen wir, wie wichtig es für langjährig bestehende Unternehmen ist, mit jemandem auf gleicher Augenhöhe eine unternehmerische Partnerschaft einzugehen. Das trifft sowohl für nationale Unternehmen als auch für unsere international agierenden Klienten zu.
Auch bei uns, kocht der Chef‘. Wir verstehen Sie und reden Klartext.
Wir verstehen Ihre Bedürfnisse und Ihre kaufmännischen Überlegungen. Insbesondere, wenn es um die Zusammenarbeit mit Anwaltskanzleien geht. Unsere Zusammenarbeit ist auch hier äußerst partnerschaftlich. Wir haben innovative Lösungsvorschläge, wie wir Ihr Unternehmen perfekt unterstützen können.
Gute Ideen brauchen einen Nährboden. Ihr habt ein Unternehmen gegründet, jeder neue Tag ist eine neue Herausforderung. Wir wollen Euer Partner sein – sowohl vom Know How, von der Beratung Eurer jungen Unternehmung, als auch finanziell. Wir helfen Euch ab dem Zeitpunkt des Seed Financing bis hin zur vollen Reife des Unternehmens. Wir begleiten die Entwicklung des Unternehmens. Mit unserer Vertragsgestaltung sind wir dynamisch auf Euer Unternehmen, Eure Bedürfnisse und Leistungsfähigkeit abgestimmt. Gerne investieren wir im Rahmen unseres Netzwerks auch in erfolgsversprechende Unternehmensideen und teilen partnerschaftlich das Risiko.
Sie haben Ihr Unternehmen über lange Zeit aufgebaut und möchten jetzt sicherstellen, dass ein geordneter Übergang stattfindet. Wir helfen Ihnen von der Suche nach einem geeigneten Nachfolger bis zur Übergabe Ihres Unternehmens mit unserer Erfahrung, unserem Netzwerk und erreichen damit eine fruchtbringende Win-Win-Situation.
Im Rahmen des Weisenheimer Netzwerks bringen wir auch gerne fachspezifische Berater mit ein, um Ihnen sämtliche Aspekte des Unternehmensübergangs holistisch zu vereinfachen.
Aufgrund langjähriger Erfahrungen in der Beratung von Klienten, die in der Luftfahrt tätig sind oder mit der Luftfahrt zu tun haben, unterstützen wir Sie sowohl durch einschlägige juristische Kenntnisse als auch mit branchenspezifischem Know How. Wir sind mit den speziellen Gepflogenheiten der Transport- und Luftfahrtindustrie im Detail vertraut und verfügen durch unser Netzwerkes auch über die dazu erforderlichen nationalen und internationalen Kontakte.
Im Bereich der Aviation beraten und unterstützen wir in den Bereichen „Financing“, „Litigation“ und „Regulatory“. Eine Referenzliste stellen wir gern auf Anfrage zur Verfügung.
UNSER CREDO
1
Enge Mandantenbindung
– wir sehen uns selbst als Teil Ihres Unternehmens.
2
Ihre Bedürfnisse sind unsere Bedürfnisse
– offenes Gesprächsklima und tiefgehendes Verständnis für Ihr Unternehmen treiben uns an.
3
Wir leben Unternehmertum
– als Unternehmer erleben wir die gleichen Erfahrungen wie Sie. Daher wissen wir: kurze Wege, rasches Handeln.
PARTNER
Martina Flitsch
Martina Flitsch ist seit 2000 als Rechtsanwältin mit den Schwerpunkten Aviation und Corporate tätig. Nach vielen Jahren als Gründungspartnerin einer namhaften Wirtschaftskanzlei wurde sie 2018 Partnerin von Weisenheimer Legal.
Ihre Expertise im Bereich Aviation hat sie durch die Inhouse-Tätigkeit bei der Austrian Airlines AG über viele Jahre erworben. Ihr Schwerpunkt lag in den letzten Jahren aber neben der kommerziellen Luftfahrt in der Beratung im Bereich Business Aviation. Unter ihren Aviation-Klienten finden sich internationale Fluglinien, Air Operator, Banken, Flugzeugeigentümer, CAMO etc. Nebenbei publiziert Martina Flitsch zu diversen Themen der Luftfahrt und ist Mitglied von luftfahrtspezifischen Organisationen und Netzwerken.
Ansonsten berät sie schwerpunktmäßig Unternehmen in Fragen des Arbeits-, Gesellschafts-, Vertrags- und Vergaberechts.
Martina Flitsch ist darüber hinaus Vortragende an der Donau-Universität Krems und Aufsichtsrätin in mehreren renommierten Unternehmen (z.B. Novomatic AG). Die Liste ihrer Publikationen finden sich anbei.
DOMINIK LEITER
Dominik Leiter ist seit 1996 als Berater zahlreicher in- und ausländischer Klienten tätig. Nach seiner langjährigen Tätigkeit in namhaften internationalen Wirtschaftskanzleien wurde er 2017 Gründungspartner von Weisenheimer Legal.
Seine Expertise hat er in einer Vielzahl von unterschiedlichen M&A- und Kapitalmarkttransaktionen erworben, aber auch bei Immobilientransaktionen (Erwerb von Immobilienportfolien oder Shoppingcentern) und bei nationalen und internationalen In- und Outsourcing-Prozessen, bei internationalen Rechtsstreitigkeiten und bei der langjährigen Betreuung von Personalabteilungen internationaler Konzerne.
Seine Klienten sind namhafte internationale Unternehmensgruppen wie auch nationale KMUs einschließlich Start Ups, die er in allen Bereichen des österreichischen und internationalen Rechts berät.
Durch seine ergänzenden Kenntnisse als Coach und Mentor, die er in den USA erworben hat, begleitet er Klienten und deren Manager bei einem optimalen Umgang mit rechtlichen Herausforderungen und einem auf den Menschen bezogenen Beratungsansatz.
Dominik Leiter ist Mitglied der International Bar Association, der Union International d’Avocats und der Europäischen Vereinigung der Arbeitsrechtsanwälte (European Employment Lawyers Association). Er ist Absolvent der juristischen Fakultät der Universität Wien sowie der Donau-Universität Krems.
Robert Leuthner
Robert Leuthner hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen in allen Bereichen von Corporate Finance, Capital Markets als auch Merger & Acquisitions. Er übernimmt auch allgemeine Rechtsberatung für Unternehmen. Er war an zahlreichen hochspezialisierten Projekten beteiligt, wie z.B. dem IPO von phion AG, dem ersten öffentlichen Midmarket Offering an der Wiener Börse. Robert Leuthner ist eingetragener Capital Market Coach (CMC) und offizieller Listing Partner der Wiener Börse. Seine Klientenstruktur umfasst sowohl Start-ups als auch langjährig bestehende Unternehmen des KMU–Standes sowie Banken und Finanzdienstleister. Er berät in allen Bereichen des österreichischen und internationalen Rechts.
Robert Leuthner ist Lektor für Unternehmensrecht im Bachelor Lehrgang ‘Management und Recht’ am Management Center Innsbruck und Autor zahlreicher juristischer Fachbeiträge für Corporate Finance-Themen. Er ist Absolvent der juristischen Fakultät der Universität Wien und hat einen Master Abschluss der Columbia University School of Law, New York, USA. Er ist in Österreich zugelassener Anwalt als auch im Bundesstaat New York, USA. Darüber hinaus agiert er als Vertrauensanwalt des Impact Hubs Wien.
DOMINIK STIBI
Dominik Stibi ist seit dem Sommer 2018 zugelassener Anwalt und Partner, somit ist er der Jüngste im Bunde der Weisenheimer.
Die für seine Tätigkeit notwendige Expertise hat er in den renommiertesten Kanzleien Wiens sowie Asiens in den Bereichen Prozessführung, IP/IT Recht, Liegenschafts-, Gesellschafts- und Arbeitsrecht erworben. Neben seinem Studium war er für die auf Insolvenz- und Verbraucherrecht spezialisierte Kanzlei Kosesnik Wehrle und Langer als juristischer Mitarbeiter bzw. als Studienassistent am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht unter em. Univ. Prof. Dr. Bernd Christian Funk tätig. Als Rechtsanwaltsanwärter absolvierte er seine Ausbildung bei Brauneis Klauser Prändl, Wolf Theiss sowie Stock Rafaseder Gruszkiewicz. Zu seinen Klienten zählen vorwiegend Start-Ups der Pharma-, Nahrungsmittel-, Hanf- und IT-Branche, welche er in allen Bereichen des österreichischen und internationalen Wirtschaftsrechts vertritt.
Er ist Absolvent der juristischen Fakultät der Universität Wien und zählt zu den Besten seines Jahrganges.

Flitsch Leuthner Leiter Rechtsanwälte GmbH
Walfischgasse 8/34
1010 Wien, Austria
tel: +43 1 361 9002-0
fax: +43 1 361 9002-999
office@weisenheimer.law
www.weisenheimer.law
WEISENHEIMER





