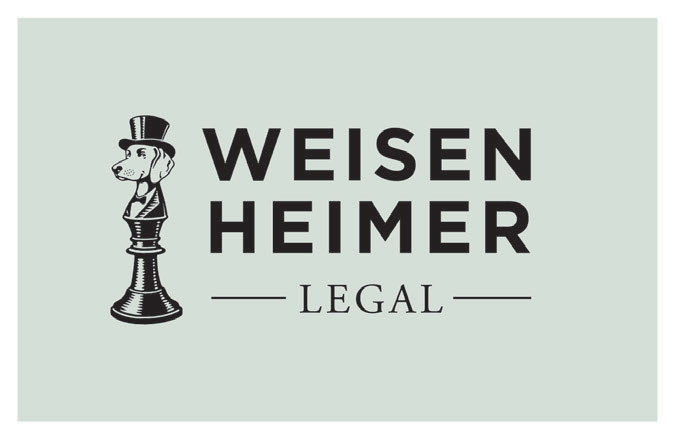Recht praktisch: Im Zeichen der E-Mobilität
Der September steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der E-Mobilität. Von 13. bis 17. September verwandelt sich der Wiener Rathausplatz zum zweiten Mal in eine Bühne für das größte E-Mobilitäts-Event Österreichs – die „Wiener Elektro Tage“. Im Mittelpunkt: Die Batterie als Energiequelle für eine grüne und klimaneutrale Zukunft.
Viele Käufer: innen und Nutzer: innen von E-Kraftfahrzeugen interessiert, was mit Altbatterien geschieht und wie sich die in Batterien enthaltenen kritischen Rohstoffe auf uns auswirken. Genau mit diesen Fragen zur Kehrseite der Medaille setzt sich die neue ,,EU-BattVO“ auseinander. Das Ergebnis ist ein Maßnahmenpaket, das den gesamten Lebenszyklus einer Batterie von der Herstellung bis zum Recycling abdeckt -mit dem klar umrissenen Ziel, die Kreislaufwirtschaft zu fördern und die negativen Auswirkungen auf unser Ökosystem und unsere Gesundheit zu minimieren.
Um diesen zentralen Anforderungen des Klimaschutzes nachzukommen, sieht die Verordnung Nachhaltigkeits-und Sicherheitskriterien für Batterien vor. So ist beispielsweise ein Mindestmaß an recyceltem Material in neuen Batterien festgelegt und bestimmte Stoffe sind bei der Herstellung verboten. Darüber hinaus sollen zukünftig Elektrofahrzeugbatterien, Batterien von E-Bikes und E-Scootern und wiederaufladbare Industriebatterien mit einer Kapazität von mehr als 2 kWh Angaben zum CO2-Fußabdruck enthalten. Die konkrete Methode und die Form der Erklärung werden allerdings noch ausgearbeitet. Ab 2027 soll außerdem ein sogenannter ,,Batteriepass“, sprich ein digitaler Pass, verpflichtend für die genannten Batteriearten eingeführt werden. Mittels QR-Codes, der an der Batterie angebracht ist, kann dann der Käufer spezifische Informationen über das Modell abrufen. Weiters wird das Sammeln und das Recycling von Altbatterien strenger reguliert. Dazu werden bestimmte Sammelziele und Anforderungen an die stoffliche Verwertung definiert, mit dem Gedanken, die Bewirtschaftung von Altbatterien positiv beeinflussen zu können.
Zur Ausgabe der KFZwirtschaft geht es hier.