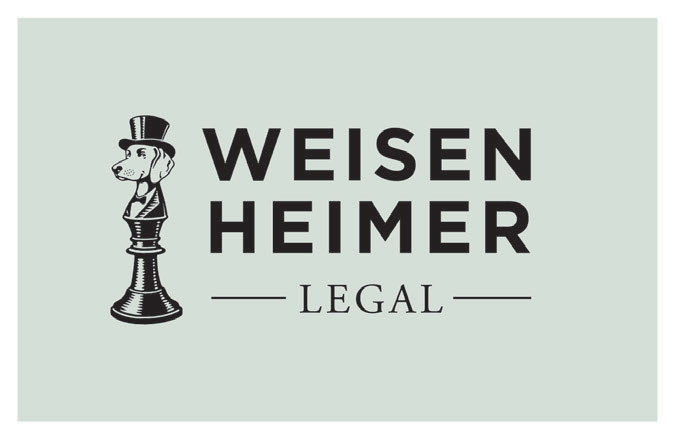Get to know your teacher – Mag. Robert Leuthner
Unser Partner, Mag. Robert Leuthner, wurde im Zuge seiner Tätigkeit als Lektor am Management Center Innsbruck für den Studiengang Management und Recht interviewt.
Hier, ein Ausschnitt aus dem Interview – Get to know your teacher!
In dieser Serie haben wir Ihre Lieblingsprofessoren aus den Bachelor- und Masterstudiengängen befragt. Heute beginnen wir mit einem der beliebtesten Dozenten in unserem Bachelorstudiengang. Mag. Robert Leuthner ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Lehrplans und verfügt über umfangreiche Erfahrung im Gesellschaftsrecht.
Wie sah Ihr beruflicher Werdegang aus und was hat Sie dazu bewogen, in Ihrem jetzigen Bereich zu arbeiten?
Von 1994 bis 1997 Associate bei Preslmayr & Partner, nach Abschluss der Columbia Law School Associate bei Cerha Hempel Spiegelfeld und CMS Strommer Reich-Rohrwig, Partner bei Hausmaninger Herbst und Haarmann Hügel (bpv Hügel) und monlaw, seit 2017 Gründungspartner von Weisenheimer Legal.
In mein heutiges Berufsfeld (Corporate-Finance-Beratung für Start-ups und KMUs) bin ich schrittweise eingestiegen. Zunächst aufgrund meiner Spezialisierung an der Columbia, durch meine Arbeit bei CHSH im Kapitalmarktrecht, dann, mangels eines ausreichend aktiven Kapitalmarktes in AT, durch die Fokussierung auf Frühphasenfinanzierung.
Gibt es eine berufliche Erfahrung oder ein Projekt, auf das Sie besonders stolz sind?
Der Börsengang der phion AG, bei dem ich eine führende rechtliche Rolle gespielt habe.
Wie sehen Sie die Zukunft der Betriebswirtschaft und des Wirtschaftsrechts und welche Fähigkeiten werden Ihrer Meinung nach in den nächsten Jahren besonders gefragt sein?
Vor allem die technischen Aspekte (Recherchen, Erstellen von Dokumenten oder Verträgen) werden in absehbarer Zeit vollständig von der KI übernommen werden. Traditionelle Redaktions- und Büroarbeiten werden verschwinden. Allerdings wird es etwas länger dauern, bis KI den Anwalt ersetzt, da KI (noch) nicht die strategischen Entscheidungen und die soziale Komponente in jeder rechtlichen Interaktion bewältigen kann.
Welchen Rat würden Sie Studenten geben, die eine Karriere in Ihrem Bereich in Betracht ziehen?
Bevor man sich für einen bestimmten Karriereweg entscheidet, sollte man sehr sorgfältig darüber nachdenken, wie sich KI in den nächsten zwanzig Jahren auf diesen Beruf auswirken wird.